Pferde, zumal Wildpferde,
sind neben ihrer offensichtlichen physischen Eigenschaft als
hochentwickelte Säugetiere von unbestreitbarer natürlicher
Schönheit und Eleganz gleichzeitig seit Alters her auch vitale
Symbole für die Unschuld eines urtümlichen, ungeteilten Lebens, das
sich selbst genügt und nichts anderes wünscht als im Einklang mit
sich und seiner Umwelt zu existieren. Es scheint also kein Zufall,
dass uns die prähistorischen Pferdebilder in den steinzeitlichen
Höhlen Südfrankreichs, Italiens oder Nordspaniens intuitiv
ansprechen und bis heute faszinieren. Philip Kerr, der Schöpfer der
international erfolgreichen und vielfach ausgezeichneten
Berlin-Noir-Reihe um den subversiven Privatdetektiv und
Ex-Kriminalpolizisten Bernie Gunter im unfreiwilligen Einsatz für
unterschiedliche Nazibehörden an verschiedenen authentischen
Kriegsschauplätzen, hat bei Recherchen zum bislang letzten Band der
Reihe in der Ukraine einige dankbare, historisch gut dokumentierte
Motive gefunden, die er nun auf durchaus spekulative, aber reizvolle
Art und Weise zu einem packenden Jugendbuch verarbeitet hat, das auf
ebenso mitreißende wie plausible Art und Weise die ewig junge Frage
nach sozialer Verantwortung und menschlichem Mitgefühl stellt.
Seine unwiderstehliche
junge Protagonistin, das vierzehnjährige Waisenmädchen Kalyna
(Kalinka genannt), ist dank des umsichtigen, uneigennützigen
Handelns einer fremden Ukrainerin dem bevorstehenden Massaker der SS
an der jüdischen Bevölkerung ihrer Heimatstadt Dnipropetrowsk
entgangen, dem anschließend allerdings ihre gesamte unmittelbare
Familie zum Opfer gefallen ist, und hat auf ihrer abenteuerlichen
Flucht allein fast 350 Kilometer zu Fuß durch ihre von den Deutschen
besetzte Heimat zurückgelegt. Dabei hat sie auf schmerzvolle Art und
Weise gelernt, dass sie keinem Menschen trauen darf, so freundlich er
sich ihr gegenüber auch verhalten mag. Im bitterkalten Winter des
Jahres 1941/42, der mit dem unter schweren Verlusten erkämpften
sowjetischen Sieg von Stalingrad eine geschichtsträchtige
entscheidende Zäsur im Kriegsverlauf erleben sollte, erreicht das
mutige Mädchen schließlich das Naturschutzgebiet Askania-Nowa in
der Südukraine, wo es trotz der dauerhaften Quartiernahme einer
SS-Einsatzgruppe in den herrschaftlichen Verwaltungsgebäuden des
weitläufigen Areals bei dem in einer einsamen Hütte lebenden alten
Tierwärter Max vorübergehend Schutz und Unterschlupf findet.
Er sah ein Mädchen von
vierzehn oder fünfzehn Jahren. Sie war groß und kräftig, aber sehr
dünn, hatte langes schmutzig braunes Haar und sah so ängstlich aus
wie ein Kaninchen in der Falle. In einer solchen Nacht musste man
sich über jeden Bewohner wundern, besonders über ein junges
Mädchen, aber noch erstaunlicher war die Tatsache, dass es von zwei
Przewalski-Pferden begleitet wurde. Sie standen links und rechts von
ihr und schützten das Mädchen mit ihren dicken Körpern vor dem
Nordostwind. […] Obwohl sie mit Schnee bedeckt waren, erkannte Max
sofort den Leithengst Temüdschin und seine beste Stute Börte.
Die geschichtlich
verbürgte, international bekannte Hauptattraktion des durch die
Kriegsereignisse vernachlässigten Tierparks ist das von dem Gründer
Askania-Nowas, dem deutschstämmigen Großgrundbesitzer Friedrich von
Falz-Fein (1863-1920), ins Leben gerufene einzigartige Zuchtprojekt
wild lebender Przewalski-Pferde, der einzigen bis heute existierenden
originären Wildpferdeart, die erst 1878 von der westlichen
Wissenschaft entdeckt wurde, als sie in ihrer zentralasiatischen
Heimat bereits kurz vor der Ausrottung stand. Sämtliche lebende
Bestände von Przewalski-Pferden in Zoos und Auswilderungsgebieten
auf der ganzen Welt stammen heute direkt von Exemplaren aus dieser
Zuchtlinie ab, ihre Physiognomie weist eine verblüffende Ähnlichkeit
zu den prähistorischen Höhlenbildern von Lascaux oder Altamtira
auf. Die lebensfeindliche Nazi-Ideologie jedoch betrachtete die im
Vergleich zum domestizierten Hauspferd augenfällig kleineren und
außerdem deutlich aggressiveren Przewalski-Pferde als regelrechte
„Unterpferde“, wie es Kerr in gewohnt ausgefeilten Dialogen dem
diabolischen SS-Offizier, Hauptmann Grenzmann, in den Mund legt:
entbehrlicher, lebensunwerter Ausschuss der Evolution, der „zu
Recht vom Aussterben bedroht ist“.
 |
| Przewalski-Pferde im Schnee/Foto: Wikimedia |
Als angesichts der
zunehmend unaufhaltsamen Gebietszugewinne sowjetischer Truppen ein
baldiger Rückzug der SS-Einsatzgruppe von Askania-Nowa unmittelbar
bevorsteht, macht Hauptmann Grenzmann dem gutherzigen, inmitten der
ostensiven Brutalität und sittlichen Verrohung der
Besatzungssoldaten stets besonnen agierenden Max eine entsetzliche
Mitteilung: aus vorauseilendem, bürokratischem Diensteifer hat er
seine vorgesetzte Stelle in Berlin nicht nur um detaillierte
Anweisungen gebeten, wie vor dem unvermeidlichen Abmarsch mit den
„primitiven Urpferden“ zu verfahren sei, sondern ist auch festen
Willens, die tatsächlich von seiner Behörde erteilten absurden
Direktiven fern jeder Überprüfbarkeit durch die Berliner Führung
lückenlos umzusetzen.
„Habe ich das nicht
schon erwähnt? Die Przewalskis sind jetzt geächtet, eine verbotene
Rasse, und müssen als solche vernichtet werden.“
„Das können Sie doch
nicht ernst meinen!“
„Es tut mir leid,
Max, aber das liegt nicht in meiner Hand. Das SS- Hauptquartier
trifft die Entscheidungen in allen Rassenangelegenheiten. Und im Fall
der Przewalski-Pferde hat Berlin mir befohlen, die Arbeit zu
vollenden, die die Natur bereits begonnen hat, Max. Nämlich eine
biologisch ungeeignete Rasse aus der Tierpopulation der Großdeutschen
Reiches zu entfernen, um die Linie von vernünftig domestizierten
Pferden […] davor zu schützen, von euren herumstreunenden
Höhlenponys verunreinigt zu werden. Das gehört alles zu unserem
Plan der völligen Zerstörung ukrainischer und asiatischer Kultur,
damit euer Volk vernünftig germanisiert werden kann. […] Ein paar
Exemplare müssen nach Berlin gebracht werden, […] damit
Reichsmarschall Göring sie auf seinem Anwesen Carinhall jagen kann.
Er ist selbst ein großer Jäger, weißt du? Doch der Rest der
Przewalski-Pferde wird ohne weitere Verzögerung erschossen.“
Am Beispiel der vollkommen
sinnlosen, technokratischen Ermordung einer ganzen Herde prächtiger
Przewalski-Pferde durch vom Beiwagen eines Motorrads abgefeuerte
Maschinengewehrsalven gelingt es Philip Kerr auf ebenso pointierte
wie glaubhafte Art und Weise, selbst noch dem oberflächlichsten,
vielleicht nur an einer spannenden Romanhandlung interessierten
jungen Leser unmissverständlich vor Augen zu führen, als wie
verlogen die hinlänglich bekannte, fast schon sprichwörtliche
Eigendarstellung der gesamten deutschen Tätergeneration tatsächlich
bewertet werden muss: man habe während der Zeit der
Selbstunterwerfung unter ein unzweifelhaft verbrecherisches Regime
niemals eine noch so geringe Wahlmöglichkeit gehabt, sondern stets
nur seine unentrinnbare Pflicht als Soldat oder Staatsbürger
verrichtet und unverhandelbaren Befehlen gehorcht, so als gäbe es
keine allgemeinen moralischen Maßstäbe, die jeder Mensch seinem
eigenen Handeln zu Grunde legt, und als habe es diese auch niemals
gegeben. Dieses von den Nationalsozialisten bewusst hervorgerufene
moralische Vakuum in der deutschen Gesellschaft ist möglicherweise
eines der am stärksten nachwirkenden Kennzeichen ihrer
lebensfeindlichen Ideologie, gerade weil es jeder Täter, Mitläufer
oder Dulder des Regimes nach der Befreiung am leichtesten hätte
aufgeben können.
 |
| Winternebel, -22° C/Foto: Vadym Serpak |
Doch gleichzeitig führt
uns Philip Kerr im weiteren Verlauf der Handlung wie nebenbei
zahlreiche geglückte Beispiele unabhängigen und selbstbestimmten
Handelns im Sinne der Humanität vor Augen: so etwa in Gestalt der
selbstlosen Retterin in Dnipropetrowsk, die die verängstigte Kalinka
aus der Marschkolonne heraus in ihren Hauseingang zieht, um sie vor
der SS zu verstecken, dem mitfühlenden Gutsverwalter Max, der sein
eigenes Leben riskiert, um das Mädchen und die seltenen Pferde vor
dem sicheren Tod zu retten oder einem erfahrenen deutschen
Nachrichtenoffizier, der am Ende des Buches zur großen Erleichterung
des Lesers einem ausdrücklichen Befehl bewusst zuwiderhandelt und so
eine entscheidende Wende herbeiführt.
Kalinka schob ihre
Hände in die Taschen ihres schwarzen Fellmantels und tastete nach
dem Kompass, dem Geld, dem Brot und dem Käse, die er so fürsorglich
hineingesteckt hatte. Die Freundlichkeit des alten Mannes ließ einen
Kloß in ihrem Hals wachsen. Sie hätte gern geweint, aber sie
wusste, dass sie es nicht konnte. […] Sie hatte gelernt, dass man
nicht weglaufen konnte, wenn man weinte, und dass man sich auch nicht
in einem Schrank verstecken konnte, ohne gehört zu werden. Wenn man
niemandem vertrauen konnte, musste man sich auf sich selbst verlassen
können. Sie hatte gedacht, irgendwann würde sie weinen können,
doch seit ihrer Flucht war das nicht passiert. Mittlerweile glaubte
sie, dass sie vielleicht niemals mehr würde weinen können, dass
etwas Menschliches zusammen mit dem Rest ihrer Familie gestorben war.
Kalinka flieht ganz auf
sich allein gestellt mit den beiden als unzähmbar geltenden
verletzten Przewalski-Pferden Temüdschin und Börte, deren Vertrauen
sie mit ihrer sensiblen, einfühlsamen Art dauerhaft gewonnen hat,
sowie begleitet von Max' treuem Wolfshund: eine erstaunlich
wehrhafte, eng verschworene, geradezu mythische Reise- und
Schicksalsgemeinschaft, die da in Wald und Steppe hinauszieht – wie
aus einem Märchen der Gebrüder Grimm. In Hauptmann Grenzmann jedoch
haben sie einen unerbittlichen, fanatischen Verfolger gefunden, der
trotz seiner musischen Interessen und einer zurückliegenden Karriere
als olympischer Reiter nichts unversucht lassen wird, den unsinnigen,
von ihm selbst heraufbeschworenen Befehl umzusetzen, mit
unverhältnismäßigem militärischen Aufwand drei unschuldige
Lebewesen zu töten, die sich nichts anderes wünschen, als
selbstbestimmt in Freiheit und Frieden zu leben. In einer fesselnden
Verfolgungsjagd mit zahlreichen überraschenden Wendungen gelingt es
dem mutigen Mädchen schließlich hinter die befreiten Frontlinien zu
gelangen. Hier allerdings muss sie sich unverhofft ganz neuen
ungeahnten Herausforderungen stellen.
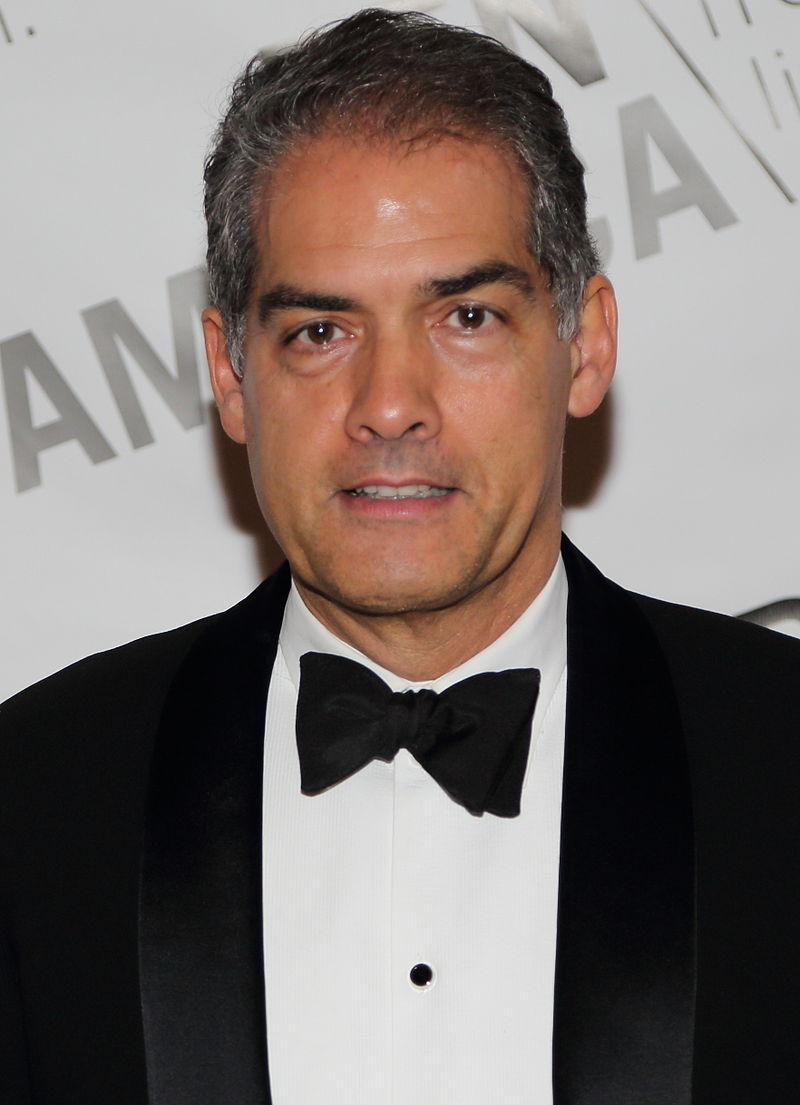 |
| Philip Kerr/Foto: Ed Lederman |
In „Winterpferde“, dem
ersten nicht unter seinem Pseudonym P.B. Kerr veröffentlichten
Jugendbuch, kann Philip Kerr sein Faible für Geschichte und
Geschichten des Zweiten Weltkriegs sowie sein außergewöhnliches
Talent für reflektierte, spannende Unterhaltungsliteratur erstmals
in vollem Maße auch für junge Leser entfalten. Dabei bewegt er sich
wie in seinen Kriminalromanen stets unmittelbar entlang belegbarer
Fakten sowie im engen Rahmen historischer Wahrscheinlichkeit. Das
Bild der seltenen Przewalski-Pferde als denkbar unschuldigste Opfer
des nationalsozialistischen Zerstörungswahns ist ein genialer,
ausgesprochen tragfähiger Schachzug. Ähnlich wie in seinen
unnachahmlichen Bernie-Gunter-Romanen enthält sich der Autor dabei
jeglicher vereinfachender Sichtweise oder kollektiver
Schuldzuweisung: so erweist sich im Verlauf der Handlung ausgerechnet
eine scheinbar hilfreiche ukrainische Bäuerin als eine der
grausamsten Gegnerinnen Kalinkas, während ein deutscher Offizier als
unverhoffter Retter in letzter Not fungiert. Der Mensch, so wie
Philip Kerr ihn beschreibt, ist niemals eindimensional, und die
Taten, zu denen er fähig ist, sind im Positiven wie im Negativen
kaum voraussehbar. In seinem ebenso engagierten wie ausgewogenen
literarischen Plädoyer für die Kraft und Schönheit des Lebens
zeigt der ausgebildete Jurist, dass Mitgefühl, Liebe und
Menschlichkeit damals wie heute ohne jede Alternative sind – doch
die Entscheidung darüber liegt ganz bei uns.
„Winterpferde“ von
Philip Kerr, aus dem Englischen von Christiane Steen, erschienen bei
Rowohlt Rotfuchs, 287 Seiten, € 16,99



.jpg)
.jpg)
.jpg)
