Wenn bei einer
Buchneuerscheinung der Anhang mehr Platz einnimmt als der eigentliche
Text, muss das den Leser unwillkürlich misstrauisch stimmen, glaubt
er doch schon vor der eigentlichen Lektüre zu ahnen, dass der Text
ohne seinen umfangreichen Erläuterungsapparat möglicherweise nicht
als eigenständiges Werk zu bestehen vermag, sondern dringend
weiterführender Erklärung oder gar wissenschaftlicher Einordnung
bedarf, um überhaupt verstanden werden zu können. Die von ihm
selbst zu investierende Mühe, wäre dann im Verhältnis zum
erwartenden intellektuellen Gewinn unter Umständen zu groß. Diese
wohlabgewogene Sorge ist allerdings im Fall des im Jahr 1995 unter
abenteuerlichen Umständen wiederentdeckten und 2014 in den USA
erstmals veröffentlichten Tagebuchs der zum Zeitpunkt der
Niederschrift vierzehnjährigen polnischen Jüdin Rywka Lipszyc über
ihre Leidenszeit im Ghetto von Lodz vollkommen unbegründet.
Dabei lohnt es sich nicht
nur, über den eigentlichen Inhalt des Tagebuchs zu sprechen, dessen
absolute Chronologie etwa sechs Monate im Jahr 1944 umfasst, sondern
auch den verstörend unfertigen Lebensweg seiner jugendlichen Autorin
nachzuverfolgen sowie die Geschichte der abenteuerlichen Auffindung
ihres Textes und seines Wegs zur erfolgreichen Publikation zu
erzählen. Rywka Lipszyc wurde 1929 in Lodz geboren, einer
wirtschaftlich florierenden multikulturellen Großstadt, deren
jüdischer Bevölkerungsanteil vor dem Zweiten Weltkrieg ein Drittel
der Gesamtbevölkerung ausmachte. Ihre Familie war streng orthodox,
ein Onkel von ihr hatte viele Jahre lang als geachteter Oberrabbiner
von Lodz gewirkt. Die Einrichtung des sogenannten Ghettos
Litzmannstadt durch die Nationalsozialisten, eines der größten
abgetrennten jüdischen Wohnviertel im besetzten Osteuropa, das heute
zu Unrecht als weniger berüchtigt gilt als das von Warschau,
veränderte das Leben der dort wahllos zusammengepferchten Juden auf
katastrophale Art und Weise, denn die Besatzer hatten für ihre
schändlichen Zwecke einen unterentwickelten Stadtbezirk ausgesucht,
dessen Wohnraum der Einwohnerzahl nicht nur vollkommen unangemessen
war, sondern nicht einmal ein funktionierendes Abwassersystem
aufwies.
Gestern Abend habe ich
mich mit Minia gestritten, ich weiß gar nicht mehr, worüber (es
ging um einen Stuhl), ich weiß nur noch, dass ich mich sehr
aufgeregt habe und weinen wollte, als ich im Bett war. Zum Glück
konnte ich weinen, aber nur ein bisschen. Ich wäre wirklich am
liebsten gestorben. Ich habe wirklich versucht, mich wieder zu
beruhigen, aber ich habe das Leben satt. Ich habe gedacht: Ich weiß,
dass ich jetzt, wo ich gern sterben würde, nicht sterben werde. Ich
werde sterben, wenn ich leben möchte, wenn ich etwas haben werde,
wofür sich zu leben lohnt. Wozu braucht man solch ein Leben? Wäre
es nicht besser, man würde sterben, wenn man nichts hat, wofür man
lebt, als dann, wenn man leben möchte? Aber auf all diese Fragen
konnte ich keine Antwort finden.
Die hermetische
Abriegelung des Ghettos durch die Deutschen bewirkte zum einen, dass
Flucht oder auch nur Informationsaustausch mit den äußeren
Stadtbezirken nahezu unmöglich war, zum anderen, dass sich
Krankheiten und Seuchen von Anfang an fast ungebremst ausbreiten
konnten – selbst ein minder schwerer grippaler Infekt konnte sich
unter diesen Umständen leicht zu einer Epidemie auswachsen, die
innerhalb weniger Wochen die vom jüdischen Ghettoverwalter Chaim
Rumkowski organisierten Manufakturen fast vollkommen zum Erliegen zu
bringen vermochte, in denen er, vermeintlicherweise um die
Bevölkerung zu schützen, sogenannte kriegswichtige Waren herstellen
ließ. Nach dem Tod von Rywkas Vaters an den Spätfolgen einer
massiven Misshandlung durch marodierende Nazis in den Tagen der
Eroberung der Stadt, dem krankheitsbedingten Tod ihrer Mutter sowie
der Deportation zweier ihrer Geschwister fand die Vierzehnjährige
mit ihrer jüngeren Schwester Cipka wenig liebevolle Aufnahme im
trostlosen Frauenhaushalt ihrer Tante und deren Töchtern, der von
Neid und Missgunst geprägt war.
 |
| Fußgängerbrücke im "Ghetto Litzmannstadt"/ |
Durch die immer noch
hilfreiche, nachhaltige Prominenz ihres verstorbenen Onkels, des
ehemaligen Oberrabbiners, gelang es dem aufgeweckten Mädchen
schnell, durch eigene Initiative an eine der begehrten und
privilegierten Stellen in einer Kleiderfabrik zu gelangen, in deren
Rahmen junge Frauen nicht nur zu Schneiderinnen ausgebildet wurden,
sondern während ihrer Arbeitszeit von zehn Stunden und mehr auch
eine gewisse rudimentäre Schulbildung erhielten. In den Abendstunden
nahm sie regelmäßig an einem Literaturkreis älterer
Mitschülerinnen teil, der ihr unter den ungünstigen
Rahmenbedingungen im Ghetto dennoch wichtigen Raum zur geistigen
Entwicklung eröffnete. Ihr ergreifend ehrliches, emotionales
Tagebuch, in dem sie immer wieder auch ihre Herzensfreundin Surcia
direkt anspricht, diente der Heranwachsenden vor allem als dankbares
Mittel zur Selbstvergewisserung in einer feindlichen Welt, die aus
der Perspektive ihrer bisherigen gut behüteten, tief religiösen
Lebenserfahrung kaum mehr zu begreifen war.
Liebe Surcia!
Manchmal denke ich, das
Leben ist ein dunkler Weg. Auf diesem Weg gibt es zwischen den Dornen
auch andere, zartere Blumen. Diese Blumen haben kein besonderes
Leben, sie leiden wegen der Dornen. Manchmal beneiden die Dornen die
anderen Blumen um ihre Schönheit und setzen ihnen noch mehr zu. Und
die Blumen werden entweder selbst zu Dornen oder leiden still und
gehen weiter auf der Dornenstraße. Nicht alle schaffen es, doch wenn
sie durchhalten, werden sie dafür belohnt. Ich glaube, das passiert
nicht oft, aber ich denke, dass jeder wahre Jude auf ein Ziel
zustrebt, still und leidend zugleich. Außerdem denke ich, das Leben
ist schön und schwer, man muss zu leben wissen. Beneidenswert sind
die Menschen, die viel gelitten haben, die durchs Leben gegangen sind
und im Kampf mit dem Leben gesiegt haben. Surcia, solche Menschen
(wenn ich etwas über solche Menschen lese oder höre) machen mir
Mut. Ich merke dann, dass ich weder die Einzige noch die Erste bin,
dass ich hoffen kann. Aber ich schreibe nicht über mich.
Doch auch der schwer
fassbare Schmerz und die vielfältigen Verunsicherungen des
Erwachsenwerdens, noch gesteigert durch den schwelenden Streit mit
ihrer Cousine um zahlreiche alltägliche Nichtigkeiten sowie ihr
fundamentales Verlassenheitsgefühl nach der Deportation und dem Tod
ihrer Eltern nehmen wichtigen Raum in Rywkas Aufzeichnungen ein.
Daneben spüren wir stets das tiefe, rührend wahrhaftige innere
Anliegen der jugendlichen Autorin, trotz der widrigen Umstände auch
vor sich selbst ein gottgefälliges, moralisch vorbildliches Leben
aufrecht zu erhalten und ihrer jüngeren Schwester ein sicherer
familiärer und freundschaftlicher Rückhalt zu sein. Dabei erkundet
sie für sich selbst und in Gesprächsrunden mit ihren Kameradinnen
auch die zahlreichen, bereits seit Jahrzehnten lebhaft diskutierten
Möglichkeiten, wie ein traditionelles jüdisches Leben auch jenseits
einer vorwiegend religiösen Definition aussehen könnte.
 |
| Näherinnen in der Kleiderfabrik, 1941/ |
Im Winter 1943/44 lassen
die Nationalsozialisten die Lebensbedingungen im Ghetto weiter
eskalieren. Die Lebensmittelrationen werden stetig reduziert,
Arbeiter mit Sonderschichten verlieren nach und nach ihre
Privilegien, und die Deportationen in die Konzentrations- und
Vernichtungslager werden häufiger und regelmäßiger. Wir müssen
davon ausgehen, dass Rywka kurze Zeit nach ihrem abrupt abgebrochenen
letzten Tagebucheintrag am 12. April 1944 nach Auschwitz deportiert
wurde. Ihre Aufzeichnungen wurden im Frühjahr 1945 von Angehörigen
der Roten Armee in den Ruinen des Konzentrationslagers gefunden –
die Heranwachsende hatte sie offensichtlich als wertvoll genug
angesehen, um sie auf ihrer Reise mitzuführen, obwohl die
Nazi-Bürokraten nur ein äußerst geringes zulässiges Gesamtgewicht
für Reisegepäck definiert hatten. Eine russische Stabsärztin nahm
das Tagebuch nach dem Krieg mit nach Sibirien, von wo aus sie ohne
Erfolg zahlreiche Versuche unternahm, Rywkas Text ins Russische
übersetzen zu lassen. Mit ihrem Nachlass gelangte das Manuskript
schließlich in die USA. Dem Engagement der langjährigen Archivarin
des Holocaust Center of Northern California, Judy Janec, ist es zu
verdanken, dass Rywka Lipszyc‘ Aufzeichnungen heute nicht nur in
gedruckter Form vorliegen, sondern auch um einen eindrucksvollen
Anhang erweitert wurden, in dem sich neben renommierten Historikern
auch Rywkas überlebenden Verwandten mit ihren Erinnerungen zu Wort
melden.
Weißt Du, manchmal,
wenn es mir sehr schlecht geht, bewundere ich das Leben. Dann komme
ich ins Grübeln. In ein und demselben Moment weinen Menschen, andere
lachen, wieder andere leiden usw. Manche werden geboren, andere
sterben, wieder andere sind krank usw. Die geboren werden, wachsen
heran und reifen, um wieder zu leben und zu leiden. Und doch wollen
alle leben, unbedingt leben, und jeder, der lebt, hat Hoffnung
(vielleicht manchmal unbewusst), und obwohl das Leben schwer ist, ist
es schön. Das Leben hat einen seltsamen Reiz. (Aber ich sage Dir die
Wahrheit, dass ich jetzt gar nicht mehr leben will, ich habe einfach
keine Kraft mehr, gleich lege ich mich schlafen und am liebsten
möchte ich gar nicht mehr aufstehen.)
Dabei scheint es durchaus
fragwürdig, die Buchausgabe anstatt mit dem voll und ganz für sich
selbst sprechenden Tagebuchtext mit einem sehr umfangreichen,
allerdings auch sehr erhellenden Vorwort des Historikers Fred
Rosenbaum beginnen zu lassen. Unabhängig von den unbestrittenen
Meriten eines ausgewiesenen Holocaust-Experten besitzt ein
autobiografischer Text (der in diesem Fall von der Autorin niemals
zur Veröffentlichung vorgesehen war, worin eine zusätzliche
Problematik besteht, über die wir gewöhnlich aus dokumentarischen
Erwägungen einfach hinweggehen) immer auch eine Dimension, die sich
besonders dem historisch interessierten Leser von ganz allein
erschließt, ohne dass er besondere Mühe darauf verwenden müsste.
Jede Stimme jedes einzelnen Opfers sollte gehört und verstanden
werden – allein daraus erschließt sich seine ganz spezifische
verlorene Lebenswelt, und allein dadurch wird das Ausmaß des von den
Nationalsozialisten entfesselten Schreckens deutlich. Dass dem
Leser hier schon vor der eigentlichen Lektüre gewissermaßen
vorgeschlagen wird, wie er das Tagebuch Rywka Lipszyc‘ aufnehmen
sollte, hat trotz der angebotenen Faktenfülle einen unangenehm
arroganten Beigeschmack.
 |
| Mahnmal am Deportationsbahnhof Radegast, Lodz/Foto: Piotr Matyja |
Ohne Frage sollten wir
niemals aufhören danach zu streben, unsere Vergangenheit verstehen
zu wollen. Allerdings scheint es fragwürdig, sie mit unserer Deutung
gleichzeitig auch für abgeschlossen zu erklären – dazu ist die
Vergangenheit zu komplex. Rywkas Geschichte indes ist mit dem
Tagebuchtext noch lange nicht auserzählt. Wir wissen, dass sie die
Konzentrations- und Todeslager, schwer vom Typhus gezeichnet,
überlebt hat und sich nach dem Krieg in Lübeck auf die Auswanderung
nach Schweden vorbereitete. In einem Krankenhaus der Hansestadt
verliert sich ihre Spur, und alle Versuche, sie wieder aufzunehmen,
sind seither gescheitert. Es existiert weder eine Sterbeurkunde noch
ein Grab noch gibt es Hinweise, dass sie unter anderem Namen
vielleicht doch weitergelebt haben könnte. Dieses spurlose Verhallen
einer verfolgten, misshandelten Seele mit all ihren unschuldigen,
reinen Plänen, Hoffnungen und Träumen macht Rywkas Schicksal noch
unerträglicher.
„Das Tagebuch der Rywka Lipszyc“, aus dem Polnischen und Englischen von Bernhard Hartmann,
erschienen im Jüdischen Verlag bei Suhrkamp, 237 Seiten, € 22,95


_(14760269186).jpg/800px-Journeys_through_Bookland_-_a_new_and_original_plan_for_reading_applied_to_the_world's_best_literature_for_children_(1922)_(14760269186).jpg)


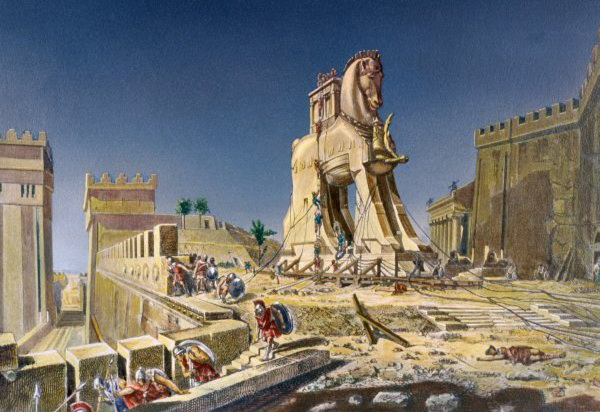
.jpg/800px-Walls_of_Troy_(1).jpg)


.jpg/800px-B%C3%BCchertisch-_B%C3%BCcher_von_Lizzie_Doron_(6981738628).jpg)
%2C_Arye_Sharuz_Shalicar_(7152304841).jpg/800px-Podium-_Eshkol_Nevo%2C_Arne_Schneider_(Moderation)%2C_Arye_Sharuz_Shalicar_(7152304841).jpg)

