In einem von Stephan Krawczyk eindringlich vertonten, anonymen Text aus der Romalyrik
(„Zigeunerlied“) vernehmen wir die unerbittliche Antwort Gottes
auf die ohnmächtige Anklage eines bitterarmen Mannes, der in seinem
harten, freudlosen Leben Tag und Nacht vergeblich schuftet, um seine
kleine Familie durchzubringen. Trotz größter, unermüdlicher
Anstrengungen tritt er buchstäblich auf der Stelle: „Oj Gott,
großer Herr, nimm mich oder lass mich leben, siehst du nicht, was du
aus uns gemacht? [...] Du bist der große Herr, wie kann ich dir im
Wege sein, was stör'n dich meine Kinder?“ – Doch der seltsam
unnahbare, ebenso allmächtige wie mitleidlose Gott antwortet mit
größter, unbegreiflicher Herzenskälte: „Ich nehm dich nicht, ich
lass dich auch nicht leben. Ich möchte nur allmählich dich zu Tode
quälen.“
Ein ähnlich freudloses,
auf den Leser wie ferngesteuert wirkendes, unerfülltes Leben führt
auch der namenlose Protagonist in Fuminori Nakamuras faszinierender
Erzählung über einen kleinen Taschendieb in Tokio. Aufgrund seiner
über einen Zeitraum von nahezu zwanzig Jahren perfekt austrainierter
Fingerfertigkeit und routinierter Menschenkenntnis muss sich dieser
zwar keinerlei Sorgen um sein wirtschaftliches Überleben machen. In
seinem Selbstverständnis als Diebeskünstler mit festen moralischen
Prinzipien, der wie selbstverständlich von anderen nimmt –
allerdings ausschließlich von Reichen –, hat er sich sogar stets
die naive Fähigkeit bewahrt, noch das wohlig-aufregende Kribbeln
während der Tat zu verspüren, das er schon als kleiner Junge
empfunden hat, als es ihn – einem unbewussten Impuls folgend –
das erste Mal zum Stehlen trieb.
„Du kannst ein neues
Leben anfangen. Es ist möglich. Vergiss das Klauen, egal ob Essen
oder Geld oder sonst was.“
„Warum denn?“
Er schaute zu mir hoch.
„Weil du sonst nie
deinen Platz in der Welt finden wirst.“
„Aber...“
„Hör auf. Vergiss es
einfach.“
Bei dem Leben, das ich
führte, war ich zweifellos nicht befugt, einem Kind Ratschläge zu
geben.
„Hier, das ist für
dich.“
Ich hielt ihm eine
kleine Schatulle hin.
„Was ist das?“
„Etwas, was ich nicht
brauche. Öffne die Schatulle erst, wenn es dir richtig schlechtgeht,
wenn du Kraft brauchst, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, und nur
noch sterben willst. Ist es nicht toll, so was zu haben?“
„Und wenn die mir
jemand klaut?“
Eines Abends beobachtet er
zufällig in einem Vorstadt-Supermarkt, wie eine Frau, eine
Prostituierte augenscheinlich, ihren kaum achtjährigen Sohn auf
vollkommen unzulängliche Art und Weise die Zutaten fürs Abendessen
zusammenstehlen lässt. Der Protagonist bemerkt, dass der Junge
bereits von der Ladendetektivin beobachtet wird und interveniert
sogleich uneigennützig und spontan, indem er die von dem kleinen
Jungen zusammengetragene Ware an sich nimmt und ganz regulär an der
Kasse für ihn bezahlt. Zunächst gegen seinen Willen entwickelt sich
in den nächsten Wochen nicht nur eine rührende Freundschaft, in
deren Rahmen der erfahrene Dieb den kleinen Jungen unter seine
Fittiche nimmt, um ihm seine besten und bewährtesten Tricks
beizubringen. Der Protagonist beginnt auch eine sexuelle Beziehung
mit dessen Mutter und steckt den beiden immer wieder erhebliche
Geldbeträge zu.
 |
| Shibuya-Bahnhof, Tokio/Foto: Stéfan Le Du |
Doch gerade als er nun
fast gegen seinen Willen zum ersten Mal seit vielen Jahren eine Art
von Gefühl von Bestimmung und mitmenschlicher Zugehörigkeit spürt,
tritt vollkommen unvermittelt die japanische Mafia in sein Leben. Vor
vielen Jahren hatte er einmal gemeinsam mit seinem seither spurlos
verschwunden Lehrmeister einen dreckigen Handlangerauftrag erledigt,
in dessen für die beiden Kleinganoven undurchschaubarem Verlauf ohne
ihr eigenes Zutun ein hochrangiges Regierungsmitglied brutal ermordet
worden war. Zu seiner eigenen Überraschung hatte der allmächtige
Yakuza-Pate ihn damals entkommen und unbehelligt weiterleben lassen.
Jetzt allerdings fordert er eine realistischerweise kaum umsetzbare
Gegenleistung dafür. Innerhalb einer Woche soll der Protagonist drei
überaus komplizierte Taschendiebstähle ausführen. Wenn er nur
einen einzigen davon nicht schafft, soll er unverzüglich sterben.
„Hast du vergessen?
Dass dein Schicksal in meinem Kopf drin ist. Geiles Gefühl!
Jedenfalls bleiben dir noch vier Tage. Daran wird sich leider nichts
ändern. Menschen wie du enden meistens so. Jetzt pass auf, was ich
dir sage: Ob du es schaffst oder nicht, macht für mich kaum einen
Unterschied. Ich ändere meine Entscheidungen nie. Wenn du es nicht
schaffst, stirbst du. Es gibt noch andere Leute, die zu den gleichen
Bedingungen für mich arbeiten. Du bist nur einer von vielen. Nur ein
winziger Teil von mir. Was die oben an der Spitze kaum kümmert, ist
für die unten eine Sache von Leben oder Tod. So funktioniert die
Welt. Und das Allerwichtigste dabei...“
Im Stil einer klassischen
Novelle berichtet der Pate dem Protagonisten in einem langen
pseudo-philosophischen Monolog ausführlich von einem grausamen
Experiment, das ein französischer Adeliger während des Zeitalters
des Absolutismus an seinem eigenen Adoptivsohn vollführt habe. Im
Verlauf von dessen kaum dreißigjährigem armseligen Leben habe er im
unmoralischen Bemühen, sich eine Ahnung göttlicher Allmacht
anzueignen, jedes Detail in dessen tragisch verlaufendem Leben von
der Adoption im Säuglingsalter bis zu seinem frühen, gewaltsamen
und von ihm selbst vollstreckten Tod bis ins kleinste Detail
vorausgeplant. Angesichts dieser schrecklichen, nachhaltig
deprimierenden Binnenerzählung ahnt der Leser schon früh, dass die
Chance für den Protagonisten auf eine erfolgreiche Ausführung
seines undurchführbar scheinenden Auftrags sowie auf ein glückliches
Ende sehr gering ist.
| Fuminori Nakamura/Foto: CurryTime7-24 |
In der eindringlichen
literarischen Thematisierung unseres schicksalhaften
Ausgeliefertseins unter die unentrinnbare Allmacht eines
unergründlichen monotheistischen Gottesbildes oder dem totalitärem
menschlichen Streben, dieses abstrakte theologische Prinzip auf die
Gesellschaft oder auf einzelne Individuen innerhalb der Gesellschaft
zu übertragen, ist Fuminori Nakamura ein wirklich
außergewöhnlicher, ebenso scharfsinniger wie unterhaltsamer
philosophischer Noir-Krimi gelungen, über den der Leser noch lange
nachgrübeln muss und der den produktiven japanischen Autor (geboren
1977) zu einer der aufregendsten Neuentdeckungen dieses
Bücherherbstes macht. Was, wenn wirklich ein großer Unbekannter die
Fäden zöge in all unserem irdischen Glück und Unglück? Was, wenn
wir wirklich nur Marionetten wären in einem Spiel, das wir von
unserem Standpunkt nicht zu durchschauen vermögen? Das lyrische Ich
des armen Rom in Stephan Krawczyks Song hat eine bescheidene,
menschliche Entgegnung auf diese großen Fragen: „Ich habe eine
schöne Frau und vier Kinder. […] Und mehr brauch ich nicht.“ -
Es ist vielleicht die einzige mögliche Antwort, zu der wir in
unserer menschlichen Unzulänglichkeit fähig sind.
„Der Dieb“, aus dem
Japanischen von Thomas Eggenberg, erschienen bei Diogenes, 211
Seiten, € 22,-

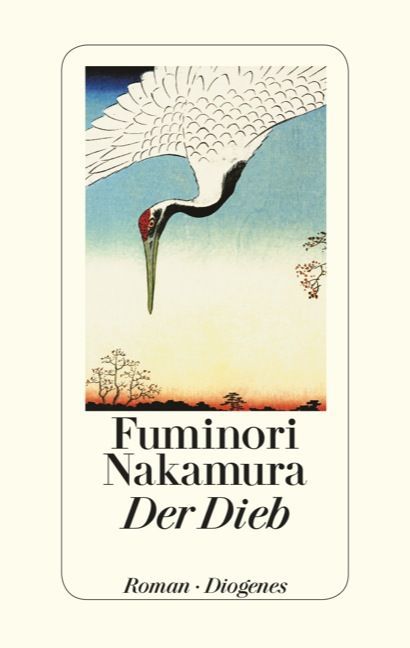
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.